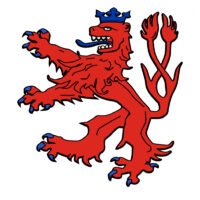Entnommen aus: Friedrich Engels, Die deutsche Reichsverfassungskampagne, Geschrieben Ende August 1849 bis Februar 1850. Aus: „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“, Hamburg. Volltext hier.
Die Aufregung wuchs inzwischen fortwährend; die Nachrichten aus allen Gegenden Deutschlands lauteten höchst kriegerisch. Endlich sollte zur Einkleidung der Landwehr geschritten werden. Die Bataillone traten zusammen und erklärten kategorisch, daß sie sich nicht einkleiden lassen würden. Die Majore, ohne hinreichende militärische Unterstützung, konnten nichts ausrichten und waren froh, wenn sie ohne Drohungen und tätliche Angriffe davonkamen. Sie entließen die Leute und setzten einen neuen Termin zur Einkleidung fest.
Die Regierung, die den Landwehroffizieren leicht die nötige Unterstützung hätte geben können, ließ es absichtlich so weit kommen. Sie wandte jetzt sofort Gewalt an.
Die widersetzlichen Landwehren gehörten namentlich dem bergisch-märkischen Industriebezirk an. Elberfeld und Iserlohn, Solingen und die Enneper Straße waren die Zentren des Widerstandes. Sofort wurden nach den beiden ersteren Städten Truppen beordert.
Nach Elberfeld zogen ein Bataillon Sechzehner, eine Schwadron Ulanen und zwei Geschütze. Die Stadt war in der höchsten Verwirrung. Die Landwehr hatte bei reiflicher Überlegung doch gefunden, daß sie ein gewagtes Spiel spiele. Viele Bauern und Arbeiter waren politisch indifferent und hatten nur keine Lust gehabt, irgendwelchen Regierungslaunen zu Gefallen auf unbestimmte Zeit sich vom Hause zu entfernen. Die Folgen der Widersetzlichkeit fielen ihnen schwer aufs Herz: species facti, Kriegsrecht, Kettenstrafe und vielleicht gar Pulver und Blei! Genug, die Anzahl der Landwehrmänner, die unter den Waffen standen – ihre Waffen hatten sie -, schmolz immer mehr zusammen, und es blieben ihrer zuletzt noch etwa vierzig übrig. Sie hatten in einem öffentlichen Lokal vor der Stadt ihr Hauptquartier aufgeschlagen und warteten dort auf die Preußen. Um das Rathaus stand die Bürgerwehr und zwei Bürgerschützenkorps, schwankend, mit der Landwehr unterhandelnd, jedenfalls entschlossen, ihr Eigentum zu schützen. In den Straßen wogte die Bevölkerung, Kleinbürger, die im politischen Klub der Reichsverfassung Treue geschworen hatten, Proletarier aller Stufen, vom entschiedenen, revolutionären Arbeiter bis zum schnapstrunkenen Karrenbinder. Kein Mensch wußte, was zu tun sei, keiner, was kommen werde.
Der Stadtrat wollte mit den Truppen unterhandeln. Der Kommandierende wies alles ab und marschierte in die Stadt. Die Truppen paradieren durch die Straßen und stellen sich am Rathause auf, gegenüber der Bürgerwehr. Man unterhandelt. Aus der Menge fallen Steinwürfe auf das Militär. Die Landwehr, wie gesagt, etwa vierzig Mann stark, zieht von der andern Seite der Stadt her nach langem Beraten ebenfalls dem Militär entgegen.
Auf einmal ruft man im Volk nach Befreiung der Gefangenen. Im Arresthaus, das dicht am Rathaus liegt, saßen nämlich seit einem Jahr 69 Solinger Arbeiter in Verhaft wegen Demolierung der Stahlgußfabnk an der Burg. Ihr Prozeß sollte in wenig Tagen verhandelt werden. Diese zu befreien, stürzt das Volk nach dem Gefängnis. Die Türen weichen, das Volk dringt ein, die Gefangenen sind frei. Aber zu gleicher Zeit rückt das Militär vor, eine Salve fällt, und der letzte Gefangene, der aus der Tür eilt, stürzt mit zerschmettertem Schädel nieder.
Das Volk weicht zurück, aber mit dem Ruf: Zu den Barrikaden! In einem Nu sind die Zugänge zur innern Stadt verschanzt. Unbewaffnete Arbeiter sind genug vorhanden, bewaffnete sind höchstens fünfzig hinter den Barrikaden.
Die Artillerie rückt vor. Wie vorher die Infanterie, so feuert auch sie zu hoch, wahrscheinlich mit Absicht. Beide Truppenteile bestanden aus Rheinländern oder Westfalen und waren gut. Endlich rückt der Hauptmann von Uttenhoven an der Spitze der 8. Kompanie des 16. Regiments vor.
Drei Bewaffnete waren hinter der ersten Barrikade. „Schießt nicht auf uns“, rufen sie, „wir schießen nur auf die Offiziere!“ – Der Hauptmann kommandiert Halt. „Kommandierst du Fertig, so liegst du da“, ruft ihm ein Schütze hinter der Barrikade zu. – „Fertig – An – Feuer!“ – Die Salve kracht, aber auch in demselben Augenblick stürzt der Hauptmann zusammen. Die Kugel hatte ihn mitten durchs Herz getroffen.
Das Peloton zieht sich eiligst zurück; nicht einmal die Leiche des Hauptmanns wird mitgenommen. Noch einige Schüsse fallen, einige Soldaten werden verwundet, und der kommandierende Offizier, der die Nacht nicht in der empörten Stadt zubringen will, zieht wieder hinaus, um mit seinen Truppen eine Stunde vor der Stadt zu biwakieren. Hinter den Soldaten erheben sich sogleich von allen Seiten Barrikaden.
Noch denselben Abend kam die Nachricht vom Rückzuge der Preußen nach Düsseldorf. Zahlreiche Gruppen bildeten sich auf den Straßen; die kleine Bourgeoisie und die Arbeiter waren in der höchsten Aufregung. Da gab das Gerücht, daß neue Truppen nach Elberfeld abgeschickt werden sollten, das Signal zum Losbruch. Ohne den Mangel an Waffen – die Bürgerwehr war seit November 1848 entwaffnet -, ohne die verhältnismäßig starke Garnison und die ungünstigen breiten und graden Straßen der kleinen Exresidenz zu bedenken, riefen einige Arbeiter zu den Barrikaden. In der Neustraße, Bolkerstraße kamen einige Verschanzungen zustande; die übrigen Teile der Stadt wurden teils durch die schon im voraus konsignierten Truppen, teils durch die Furcht der großen und kleinen Bürgerschaft frei gehalten.
Gegen Abend entspann sich der Kampf. Die Barrikadenkämpfer waren, hier wie überall, wenig zahlreich. Wo sollten sie auch Waffen und Munition hernehmen? Genug, sie leisteten der Übermacht langen und tapfern Widerstand, und erst nach ausgedehnter Anwendung der Artillerie, gegen Morgen, war das halbe Dutzend Barrikaden, das sich verteidigen ließ, in den Händen der Preußen. Man weiß, daß diese vorsichtigen Helden am folgenden Tage an Dienstmädchen, Greisen und friedlichen Leuten überhaupt blutige Revanche nahmen.
An demselben Tage, an dem die Preußen aus Elberfeld zurückgeschlagen wurden, sollte auch ein Bataillon, wenn wir nicht irren des 13. Regiments, nach Iserlohn einrücken und die dortige Landwehr zur Räson bringen. Aber auch hier wurde dieser Plan vereitelt; sowie die Nachricht vom Anrücken des Militärs bekannt wurde, verschanzte Landwehr und Volk alle Zugänge der Stadt und erwartete den Feind mit geladener Büchse. Das Bataillon wagte keinen Angriff und zog sich wieder zurück.
Der Kampf in Elberfeld und Düsseldorf und die Verbarrikadierung Iserlohns gaben das Signal zum Aufstand des größten Teils der bergisch-märkischen Industriegegend. Die Solinger stürmten das Gräfrather Zeughaus und bewaffneten sich mit den daraus entnommenen Gewehren und Patronen; die Hagener schlossen sich in Masse der Bewegung an, bewaffneten sich, besetzten die Zugänge der Ruhr und schickten Rekognoszierungspatrouillen aus; Solingen, Ronsdorf, Remscheid, Barmen usw. stellten ihre Kontingente nach Elberfeld. An den übrigen Orten der Gegend erklärte sich die Landwehr für die Bewegung und stellte sich zur Verfügung der Frankfurter Versammlung. Elberfeld, Solingen, Hagen, Iserlohn setzten Sicherheitsausschüsse an die Stelle der vertriebenen Kreis- und Lokalbehörden.
Die Nachrichten von diesen Ereignissen wurden natürlich noch ungeheuer übertrieben. Man schilderte die ganze Wupper- und Ruhrgegend als ein großes, organisiertes Lager des Aufstandes, man sprach von fünfzehntausend Bewaffneten in Elberfeld, von ebensoviel in Iserlohn und Hagen. Der plötzliche Schreck der Regierung, der alle ihre Tätigkeit gegenüber diesem Aufstande der treuesten Bezirke mit einem Schlage lähmte, trug nicht wenig dazu bei, diesen Übertreibungen Glauben zu verschaffen.
Alle billigen Abzüge für wahrscheinliche Übertreibungen gemacht, blieb das eine Faktum unleugbar, daß die Hauptorte des bergisch-märkischen Industriebezirks im offnen und bis dahin siegreichen Aufstande begriffen waren. Dies Faktum war da. Dazu kamen die Nachrichten, daß Dresden sich noch hielt, daß Schlesien gäre, daß die Pfälzer Bewegung sich konsolidiere, daß in Baden eine siegreiche Militärrevolte ausgebrochen und der Großherzog geflohen sei, daß die Magyaren am Jablunka und der Leitha ständen. Kurz, von allen revolutionären Chancen, die sich der demokratischen und Arbeiterpartei seit März 1848 geboten hatten, war dies bei weitem die vorteilhafteste, und sie mußte natürlich ergriffen werden. Das linke Rheinufer durfte das rechte nicht im Stich lassen,
Was war nun zu tun?
Alle größeren Städte der Rheinprovinz sind entweder von starken Zitadellen und Forts beherrschte Festungen, wie Köln und Koblenz, oder haben zahlreiche Garnisonen, wie Aachen, Düsseldorf und Trier. Außerdem wird die Provinz noch durch die Festungen Wesel, Jülich, Luxemburg, Saarlouis und selbst durch Mainz und Minden im Zaum gehalten. In diesen Festungen und Garnisonen lagen zusammen mindestens dreißigtausend Mann. Köln, Düsseldorf, Aachen, Trier waren endlich seit längerer Zeit entwaffnet. Die revolutionären Zentren der Provinz waren also gelähmt. Jeder Aufstandsversuch mußte hier, wie dies sich schon in Düsseldorf gezeigt, mit dem Siege des Militärs endigen; noch ein solcher Sieg, z.B. in Köln, und der bergisch-märkische Aufstand war trotz der sonst günstigen Nachrichten moralisch vernichtet. Auf dem linken Rheinufer war an der Mosel, in der Eifel und dem Krefelder Industriebezirk eine Bewegung möglich; aber diese Gegend war von sechs Festungen und drei Garnisonsstädten umzingelt. Das rechte Rheinufer bot dagegen in den bereits insurgierten Bezirken ein dichtbevölkertes, ausgedehntes, durch Wald und Gebirge zum Insurrektionskriege wie geschaffenes Terrain dar.
Wollte man also die aufgestandenen Bezirke unterstützen, so war nur eins möglich:
vor allen Dingen in den Festungen und Garnisonsstädten jeden unnützen Krawall vermeiden;
auf dem linken Rheinufer in den kleineren Städten, in den Fabrikorten und auf dem Lande eine Diversion machen, um die rheinischen Garnisonen im Schach zu halten;
endlich alle disponiblen Kräfte in den insurgierten Bezirk des rechten Rheinufers werfen, die Insurrektion weiter verbreiten und versuchen, hier vermittelst der Landwehr den Kern einer revolutionären Armee zu organisieren.
Die neuen preußischen Enthüllungshelden mögen nicht zu früh frohlocken über das hier enthüllte hochverräterische Komplott. Leider hat kein Komplott existiert. Die obigen drei Maßregeln sind kein Verschwörungsplan, sondern ein einfacher Vorschlag, der vom Schreiber dieser Zeilen ausging, und zwar in dem Augenblick, als er selbst nach Elberfeld abreiste, um die Ausführung des dritten Punkts zu betreiben. Dank der zerfallenen Organisation der demokratischen und Arbeiterpartei, dank der Unschlüssigkeit und klugen Zurückhaltung der meisten aus der kleinen Bourgeoisie hervorgegangenen Lokalführer, dank endlich dem Mangel an Zeit kam es gar nicht zum Konspirieren. Wenn daher auf dem linken Rheinufer allerdings der Anfang einer Diversion zustande kam, wenn in Kempen, Neuß und Umgegend Unruhen ausbrachen und in Prüm das Zeughaus gestürmt wurde, so waren diese Tatsachen keineswegs Folgen eines gemeinsamen Plans, sie wurden nur durch den revolutionären Instinkt der Bevölkerung hervorgerufen.
In den insurgierten Bezirken sah es inzwischen ganz anders aus, als die übrige Provinz voraussetzte. Elberfeld mit seinen – übrigens höchst planlosen und eilig zusammengerafften – Barrikaden, mit den vielen Wachtposten, Patrouillen und sonstigen Bewaffneten, mit der ganzen Bevölkerung auf den Straßen, wo nur die große Bourgeoisie zu fehlen schien, mit den roten und trikoloren Fahnen nahm sich zwar gar nicht übel aus, im übrigen aber herrschte in der Stadt die größte Verwirrung. Die kleine Bourgeoisie hatte durch den gleich im ersten Moment gebildeten Sicherheitsausschuß die Leitung der Angelegenheiten in die Hand genommen. Kaum war sie soweit, als sie auch schon vor ihrer eignen Macht, so gering sie war, erschrak. Ihre erste Handlung war, sich durch den Stadtrat, d.h. durch die große Bourgeoisie, legitimieren zu lassen und zum Dank für die Gefälligkeit des Stadtrats fünf seiner Mitglieder in den Sicherheitsausschuß aufzunehmen. Dieser so verstärkte Sicherheitsausschuß entledigte sich denn sofort aller gefährlichen Tätigkeit, indem er die Sorge für die Sicherheit nach außen einer Militärkommission überwies, sich selbst aber über diese Kommission eine mäßigende und hemmende Aufsicht vorbehielt. Somit vor aller Berührung mit dem Aufstande gesichert, durch die Väter der Stadt selbst auf den Rechtsboden verpflanzt, konnten die zitternden Kleinbürger des Sicherheitsausschusses sich darauf beschränken, die Gemüter zu beruhigen, die laufenden Geschäfte zu besorgen, „Mißverständnisse“ aufzuklären, abzuwiegeln, die Sache in die Lange zu ziehn und jede energische Tätigkeit unter dem Vorwande zu lähmen, man müsse vorerst die Antwort auf die nach Berlin und Frankfurt geschickten Deputationen abwarten. Die übrige Kleinbürgerschaft ging natürlich Hand in Hand mit dem Sicherheitsausschuß, wiegelte überall ab, verhinderte möglichst alle Fortführung der Verteidigungsmaßregeln und der Bewaffnung und schwankte fortwährend über die Grenze ihrer Beteiligung am Aufstande. Nur ein kleiner Teil dieser Klasse war entschlossen, sich mit den Waffen in der Hand zu verteidigen, falls die Stadt angegriffen würde. Die große Mehrzahl suchte sich selbst einzureden, ihre bloßen Drohungen und die Scheu vor dem fast unvermeidlichen Bombardement Elberfelds werde die Regierung zu Konzessionen bewegen; im übrigen aber hielt sie sich für alle Fälle den Rücken frei.
Die große Bourgeoisie war im ersten Augenblick nach dem Gefecht wie niedergedonnert. Sie sah Brandstiftung, Mord, Plünderung und wer weiß welche Greuel vor ihrer erschreckten Phantasie aus der Erde wachsen. Die Konstituierung des Sicherheitsausschusses, dessen Majorität – Stadträte, Advokaten, Staatsprokuratoren, gesetzte Leute – ihr plötzlich eine Garantie für Leben und Eigentum bot, erfüllte sie daher mit einem mehr als fanatischen Entzücken. Dieselben großen Kaufleute, Türkischrotfärber, Fabrikanten, die bisher die Herren Karl Hecker, Riotte, Höchster usw. als blutdürstige Terroristen verschrien hatten, stürzten jetzt in Masse aufs Rathaus, umarmten ebendieselbigen angeblichen Blutsäufer mit der fieberhaftesten Innigkeit und deponierten Tausende von Talern auf dem Tische des Sicherheitsausschusses. Es versteht sich von selbst, daß ebendieselben begeisterten Bewunderer und Unterstützer des Sicherheitsausschusses nach dem Ende der Bewegung nicht nur über die Bewegung selbst, sondern auch über den Sicherheitsausschuß und seine Mitglieder die abgeschmacktesten und gemeinsten Lügen verbreiteten und den Preußen mit derselben Innigkeit für die Befreiung von einem Terrorismus dankten, der nie existiert hatte. Unschuldige konstitutionelle Bürger, wie die Herren Heeker, Höchster und der Staatsprokurator Heintzmann, wurden wieder als Schreckensmänner und Menschenfresser geschildert, denen die Verwandtschaft mit Robespierre und Danton auf dem Gesicht geschrieben stand. Wir halten es für unsre Schuldigkeit, unsrerseits genannte Biedermänner von dieser Anklage vollständig freizusprechen. Im übrigen begab sich der größte Teil der hohen Bourgeoisie möglichst rasch mit Weib und Kind unter den Schutz des Düsseldorfer Belagerungszustandes, und nur der kleinere couragiertere Teil blieb zurück, um sein Eigentum auf alle Fälle zu schützen. Der Oberbürgermeister saß während des Aufstandes verborgen in einer umgeworfenen, mit Mist bedeckten Droschke. Das Proletariat, einig im Moment des Kampfes, spaltete sich, sobald das Schwanken des Sicherheitsausschusses und der Kleinbürgerschaft hervortrat. Die Handwerker, die eigentlichen Fabrikarbeiter, ein Teil der Seidenweber waren entschieden für die Bewegung; aber sie, die den Kern des Proletariats bildeten, hatten fast gar keine Waffen. Die Rotfärber, eine robuste, gut bezahlte Arbeiterklasse, roh und deshalb reaktionär wie alle Fraktionen von Arbeitern, bei deren Geschäft es mehr auf Körperkraft als auf Geschicklichkeit ankommt, waren schon in den ersten Tagen gänzlich gleichgültig geworden. Sie allein von allen Industriearbeitern arbeiteten während der Barrikadenzeit fort, ohne sich stören zu lassen. Das Lumpenproletariat endlich war wie überall vom zweiten Tage der Bewegung an käuflich, verlangte morgens vom Sicherheitsausschuß Waffen und Sold und ließ sich nachmittags von der großen Bourgeoisie erkaufen, um ihre Gebäude zu schützen oder um abends die Barrikaden niederzureißen. Im ganzen stand es auf der Seite der Bourgeoisie, die ihm am besten zahlte und mit deren Geld es während der Dauer der Bewegung sich flotte Tage machte.
Die Nachlässigkeit und Feigheit des Sicherheitsausschusses, die Uneinigkeit der Militärkommission, in der die Partei der Untätigkeit anfangs die Majorität hatte, verhinderten von vornherein jedes entschiedene Auftreten. Vom zweiten Tage an trat die Reaktion ein. Von Anfang an zeigte es sich, daß in Elberfeld nur unter der Fahne der Reichsverfassung, nur im Einverständnisse mit der kleinen Bourgeoisie auf Erfolg zu rechnen war. Das Proletariat war einerseits gerade hier erst zu kurze Zeit aus der Versumpfung des Schnapses und des Pietismus herausgerissen, als daß die geringste Anschauung von den Bedingungen seiner Befreiung hätte in die Massen dringen können, andrerseits hatte es einen zu instinktiven Haß gegen die Bourgeoisie, war es viel zu gleichgültig gegen die bürgerliche Frage der Reichsverfassung, als daß es sich für dergleichen trikolore Interessen hätte enthusiasmieren können. Die entschiedene Partei, die einzige, der es mit der Verteidigung Ernst war, kam dadurch in eine schiefe Stellung. Sie erklärte sich für die Reichsverfassung. Aber die kleine Bourgeoisie traute ihr nicht, verlästerte sie in jeder Weise beim Volke, hemmte alle ihre Maßregeln zur Bewaffnung und Befestigung. Jeder Befehl, der dazu dienen konnte, die Stadt wirklich in Verteidigungszustand zu setzen, wurde sofort kontremandiert vom ersten besten Mitglied des Sicherheitsausschusses. Jeder Spießbürger, dem man eine Barrikade vor die Türe setzte, lief sogleich aufs Rathaus und verschaffte sich einen Gegenbefehl. Die Geldmittel zur Bezahlung der Barrikadenarbeiter – und sie verlangten nur das Nötigste, um nicht zu verhungern – waren nur mit Mühe und im knappsten Maß vom Sicherheitsausschuß herauszupressen. Der Sold und die Verpflegung der Bewaffneten wurde unregelmäßig besorgt und war oft unzureichend. Während fünf bis sechs Tage war weder Revue noch Appell der Bewaffneten zustande zu bringen, so daß kein Mensch wußte, auf wieviel Kämpfer man für den Notfall rechnen konnte. Erst am fünften Tage wurde eine Einteilung der Bewaffneten versucht, die aber nie zur Ausführung kam und auf einer totalen Unkenntnis der Streitkräfte beruhte. Jedes Mitglied des Sicherheitsausschusses agierte auf eigene Faust. Die widersprechendsten Befehle durchkreuzten sich, und nur darin stimmten die meisten dieser Befehle überein, daß sie die gemütliche Konfusion vermehrten und jeden energischen Schritt verhinderten. Dem Proletariat wurde dadurch vollends die Bewegung verleidet, und nach wenigen Tagen erreichten die großen Bourgeois und die Kleinbürger ihren Zweck, die Arbeiter möglichst gleichgültig zu machen.
Als ich am 11. Mai nach Elberfeld kam, waren wenigstens 2.500-3.000 Bewaffnete vorhanden. Von diesen Bewaffneten waren aber nur die fremden Zuzüge und die wenigen bewaffneten Elberfelder Arbeiter zuverlässig. Die Landwehr schwankte; die Mehrzahl hatte ein gewaltiges Grauen vor der Kettenstrafe. Sie waren anfangs wenig zahlreich, verstärkten sich aber durch den Zutritt aller Unentschiedenen und Furchtsamen aus den übrigen Detachements. Die Bürgerwehr endlich, hier vom Anfang an reaktionär und direkt zur Unterdrückung der Arbeiter errichtet, erklärte sich neutral und wollte bloß ihr Eigentum schützen. Alles dies stellte sich indes erst im Laufe der nächsten Tage heraus; inzwischen aber verlief sich ein Teil der fremden Zuzüge und der Arbeiter, schmolz die Zahl der wirklichen Streitkräfte infolge des Stillstandes der Bewegung zusammen, während die Bürgerwehr immer mehr zusammenhielt und mit jedem Tage ihre reaktionären Gelüste unverhohlener aussprach. Sie riß in den letzten Nächten schon eine Anzahl Barrikaden nieder. Die bewaffneten Zuzüge, die im Anfang gewiß über 1.000 Mann betrugen, hatten sich am 12. oder 13. schon auf die Hälfte reduziert, und als es endlich zu einem Generalappell kam, stellte sich heraus, daß die ganze bewaffnete Macht, auf die man rechnen konnte, höchstens noch 700 bis 800 Mann betrug. Landwehr und Bürgerwehr weigerten sich, auf diesem Appell zu erscheinen.
Damit nicht genug. Das insurgierte Elberfeld war von lauter angeblich „neutralen“ Orten umgeben. Barmen, Kronenberg, Lennep, Lüttringhausen usw. hatten sich der Bewegung nicht angeschlossen. Die revolutionären Arbeiter dieser Orte, soweit sie Waffen hatten, waren nach Elberfeld marschiert. Die Bürgerwehr, in allen diesen Orten reines Instrument in den Händen der Fabrikanten zur Niederhaltung der Arbeiter, aus den Fabrikanten, ihren Fabrikaufsehern und den von den Fabrikanten gänzlich abhängigen Krämern zusammengesetzt, beherrschte diese Orte im Interesse der „Ordnung“ und der Fabrikanten. Die Arbeiter selbst, durch ihre mehr ländliche Zerstreuung der politischen Bewegung ziemlich fremd gehalten, waren durch Anwendung der bekannten Zwangsmittel und durch Verleumdung über den Charakter der Elberfelder Bewegung teilweise auf die Seite der Fabrikanten gebracht; bei den Bauern wirkte die Verleumdung vollends unfehlbar. Dazu kam, daß die Bewegung in eine Zeit fiel, wo nach fünfzehnmonatlicher Geschäftskrise die Fabrikanten endlich wieder Aufträge vollauf hatten, und daß, wie bekannt, mit gut beschäftigten Arbeitern keine Revolution zu machen ist – ein Umstand, der auch in Elberfeld sehr bedeutend wirkte. Daß unter allen diesen Umständen die „neutralen“ Nachbarn nur ebensoviel versteckte Feinde waren, liegt auf der Hand.
Noch mehr. Die Verbindung mit den übrigen insurgierten Bezirken war keineswegs hergestellt. Von Zeit zu Zeit kamen einzelne Leute von Hagen herüber; von Iserlohn wußte man so gut wie gar nichts. Es boten sich einzelne Leute zu Kommissären an, aber keinem war zu trauen. Mehrere Boten zwischen Elberfeld und Hagen sollen in Barmen und Umgegend von der Bürgerwehr arretiert worden sein. Der einzige Ort, mit dem man in Verbindung stand, war Solingen, und dort sah es geradeso aus wie in Elberfeld. Daß es nicht schlimmer dort aussah, war nur der guten Organisation und der Entschlossenheit der Solinger Arbeiter zu verdanken, die 400 bis 500 Bewaffnete nach Elberfeld geschickt hatten, [aber] immer noch stark genug waren, ihrer Bourgeoisie und ihrer Bürgerwehr zu Hause das Gleichgewicht zu halten. Wären die Elberfelder Arbeiter so entwickelt und so organisiert gewesen wie die Solinger, die Chancen hätten ganz anders gestanden.
Unter diesen Umständen war nur noch eins möglich: Ergreifung einiger rascher, energischer Maßregeln, die der Bewegung wieder Leben verliehen, ihr neue Streitkräfte zuführten, ihre inneren Gegner lähmten und sie im ganzen bergisch-märkischen Industriebezirk möglichst kräftig organisierten. Der erste Schritt war die Entwaffnung der Elberfelder Bürgerwehr und die Verteilung ihrer Waffen unter die Arbeiter und die Erhebung einer Zwangssteuer zum Unterhalt der so bewaffneten Arbeiter. Dieser Schritt brach entschieden mit der ganzen bisherigen Schlaffheit des Sicherheitsausschusses, gab dem Proletariat neues Leben und lähmte die Widerstandsfähigkeit der „neutralen“ Distrikte. Was nachher zu tun war, um auch aus diesen Distrikten Waffen zu erhalten, die Insurrektion weiter auszudehnen und die Verteidigung des ganzen Bezirks regelmäßig zu organisieren, hing von dem Erfolge dieses ersten Schrittes ab. Mit einem Beschluß des Sicherheitsausschusses in der Hand und mit den vierhundert Solingern allein wäre übrigens die Elberfelder Bürgerwehr im Nu entwaffnet gewesen. Ihr Heldenmut war nicht der Rede wert.
Der Sicherheit der noch im Gefängnis gehaltenen Elberfelder Maiangeklagten bin ich die Erklärung schuldig, daß alle diese Vorschläge einzig und allein von mir ausgingen. Die Entwaffnung der Bürgerwehr vertrat ich vom ersten Augenblicke an, als die Geldmittel des Sicherheitsausschusses zu schwinden begannen.
Aber der löbliche Sicherheitsausschuß fand sich durchaus nicht gemüßigt, auf dergleichen „terroristische Maßregeln“ einzugehen. Das einzige, was ich durchsetzte, oder vielmehr mit einigen Korpsführern – die alle glücklich entkamen und teilweise schon in Amerika sind – auf eigene Faust ausführen ließ, war die Abholung von etwa achtzig Gewehren der Kronenberger Bürgerwehr, die auf dem dortigen Rathaus aufbewahrt wurden. Und diese Gewehre, höchst leichtsinnig verteilt, kamen meistens in die Hände von schnapslustigen Lumpenproletariern, die sie denselben Abend noch an die Bourgeois verkauften. Diese Herren Bourgeois nämlich schickten Agenten unter das Volk, um möglichst viele Gewehre aufzukaufen, und zahlten einen ziemlich hohen Preis dafür. Das Elberlelder Lumpenproletariat hat so mehrere Hundert Gewehre den Bourgeois abgeliefert, die ihm durch die Nachlässigkeit und Unordnung der improvisierten Behörden in die Hände geraten waren. Mit diesen Gewehren wurden die Fabrikaufseher, die zuverlässigsten Färber etc. etc. bewaffnet, und die Reihen der „gutgesinnten“ Bürgerwehr verstärkten sich von Tage zu Tage.
Die Herren vom Sicherheitsausschuß antworteten auf jeden Vorschlag zur bessern Verteidigung der Stadt, das sei ja alles unnütz, die Preußen würden sich sehr hüten zu kommen, sie würden sich nicht in die Berge wagen usw. Sie selbst wußten sehr gut, daß sie damit die plumpsten Märchen verbreiteten, daß die Stadt von allen Höhen selbst mit Feldgeschütz zu beschießen, daß gar nichts auf eine nur einigermaßen ernsthafte Verteidigung eingerichtet war und daß bei dem Stillstand der Insurrektion und der kolossalen preußischen Übermacht nur noch ganz außerordentliche Ereignisse den Elberfelder Aufstand retten konnten.
Die preußische Generalität schien indes auch keine rechte Lust zu haben, sich auf ein ihr so gut wie gänzlich unbekanntes Terrain zu begeben, bevor sie eine in jedem Fall wahrhaft erdrückende Streitmacht zusammengezogen. Die vier offnen Städte Elberfeld, Hagen, Iserlohn und Solingen imponierten diesen vorsichtigen Kriegshelden so sehr, daß sie eine vollständige Armee von zwanzigtausend Mann nebst zahlreicher Kavallerie und Artillerie aus Wesel, Westfalen und den östlichen Provinzen, zum Teil mit der Eisenbahn, herankommen und, ohne einen Angriff zu wagen, hinter der Ruhr eine regelrechte strategische Aufstellung formieren ließen. Oberkommando und Generalstab, rechter Flügel, Zentrum, alles war in der schönsten Ordnung, gerade als habe man eine kolossale feindliche Armee sich gegenüber, als gelte es eine Schlacht gegen einen Bem oder Dembinski, nicht aber einen ungleichen Kampf gegen einige hundert unorganisierter Arbeiter, schlecht bewaffnet, fast ohne Führer und im Rücken verraten von denen, die ihnen die Waffen in die Hand gegeben hatten.
Man weiß, wie die Insurrektion geendigt hat. Man weiß, wie die Arbeiter, überdrüssig des ewigen Hinhaltens, der zaudernden Feigheit und des verräterischen Einschläferns der Kleinbürgerschaft, endlich von Elberfeld auszogen, um sich nach dem ersten besten Lande durchzuschlagen, in dem die Reichsverfassung ihnen irgendwelchen Schutz böte. Man weiß, welche Hetzjagd auf sie durch preußische Ulanen und aufgestachelte Bauern gemacht worden ist. Man weiß, wie sogleich nach ihrem Abzug die große Bourgeoisie wieder hervorkroch, die Barrikaden abtragen ließ und den herannahenden preußischen Helden Ehrenpforten baute. Man weiß, wie Hagen und Solingen durch direkten Verrat der Bourgeoisie den Preußen in die Hände gespielt wurde und nur Iserlohn den mit Beute schon beladenen Siegern von Dresden, dem 24. Regiment, einen zweistündigen ungleichen Kampf lieferte.
Ein Teil der Elberfelder, Solinger und Mülheimer Arbeiter kam glücklich durch nach der Pfalz. Hier fanden sie ihre Landsleute, die Flüchtlinge vom Prümer Zeughaussturm. Mit diesen zusammen bildeten sie eine fast nur aus Rheinländern bestehende Kompanie im Willichschen Freikorps. Alle ihre Kameraden müssen ihnen das Zeugnis geben, daß sie sich, wo sie ins Feuer kamen, und namentlich in dem letzten entscheidenden Kampf an der Murg, sehr brav geschlagen haben.
Die Elberfelder Insurrektion verdiente schon deshalb eine ausführlichere Schilderung, weil gerade hier die Stellung der verschiedenen Klassen in der Reichsverfassungsbewegung am schärfsten ausgesprochen, am weitesten entwickelt war. In den übrigen bergisch-märkischen Städten glich die Bewegung vollständig der Elberfelder, nur daß dort die Beteiligung oder Nichtbeteiligung der verschiedenen Klassen an der Bewegung mehr durcheinanderläuft, weil dort die Klassen selbst nicht so scharf geschieden sind wie im industriellen Zentrum des Bezirks. In der Pfalz und in Baden, wo die konzentrierte große Industrie, mit ihr die entwickelte große Bourgeoisie fast gar nicht existiert, wo die Klassenverhältnisse viel gemütlicher und patriarchalischer durcheinanderschwimmen, war die Mischung der Klassen, die die Träger der Bewegung waren, noch viel verworrener. Wir werden dies später sehen, wir werden aber auch zugleich sehen, wie alle diese Beimischungen des Aufstandes sich schließlich ebenfalls um die Kleinbürgerschaft als den Kristallisationskern der ganzen Reichsverfassungsherrlichkeit gruppieren.
Die Aufstandsversuche in Rheinpreußen im Mai v.J. stellen deutlich heraus, welche Stellung dieser Teil Deutschlands in einer revolutionären Bewegung einnehmen kann. Umzingelt von sieben Festungen, davon drei für Deutschland ersten Ranges, fortwährend besetzt von fast dem dritten Teil der ganzen preußischen Armee, durchschnitten in allen Richtungen von Eisenbahnen, mit einer ganzen Dampftransportflotte zur Verfügung der Militärmacht, hat ein rheinischer Aufstand nur unter ganz außerordentlichen Bedingungen Chance des Erfolgs. Nur wenn die Zitadellen in den Händen des Volks sind, können die Rheinländer mit den Waffen in der Hand etwas ausrichten. Und dieser Fall kann nur eintreten, entweder wenn die Militärgewalt durch gewaltige äußere Ereignisse terrorisiert und kopflos gemacht wird oder wenn das Militär sich ganz oder teilweise für die Bewegung erklärt. In jedem andern Falle ist ein Aufstand in der Rheinprovinz von vornherein verloren. Ein rascher Marsch der Badenser nach Frankfurt und der Pfälzer nach Trier hätte wahrscheinlich die Wirkung gehabt, daß der Aufstand an der Mosel und in der Eifel, in Nassau und den beiden Hessen sofort losgebrochen wäre, daß die damals noch gutgestimmten Truppen der mittelrheinischen Staaten sich der Bewegung angeschlossen hätten. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß alle rheinischen Truppen, und namentlich die ganze 7. und 8. Artilleriebrigade, ihrem Beispiele gefolgt wären, daß sie wenigstens ihre Gesinnung laut genug kundgegeben hätten, um der preußischen Generalität den Kopf verlieren zu machen. Wahrscheinlich wären mehrere Festungen in die Hände des Volkes gefallen, und wenn auch nicht Elberfeld, so war doch jedenfalls der größte Teil des linken Rheinufers gerettet. Alles das, und vielleicht noch viel mehr, ist verlorengegangen durch die schäbige, pfahlbürgerlich-feige Politik des hochweisen badischen Landesausschusses.
Mit der Niederlage der rheinischen Arbeiter ging auch das Blatt zugrunde, in dem allein sie ihre Interessen offen und entschieden vertreten sahen – die „Neue Rhein[ische] Zeitung“. Der Redakteur en chef, obwohl geborner Rheinpreuße, wurde aus Preußen ausgewiesen, den andern Redakteuren stand, den einen direkte Verhaftung, den andern sofortige Ausweisung bevor. Die Kölner Polizei erklärte dies mit der größten Naivetät und bewies ganz detailliert, daß sie gegen jeden genug Tatsachen wisse, um in der einen oder andern Weise einschreiten zu können. Somit mußte das Blatt in dem Augenblick, wo die unerhört rasch gewachsene Verbreitung seine Existenz mehr als sicherstellte, aufhören zu erscheinen. Die Redakteure verteilten sich auf die verschiedenen insurgierten oder noch zu insurgierenden deutschen Länder; mehrere gingen nach Paris, wo ein abermaliger Wendepunkt bevorstand. Es ist keiner unter ihnen, der nicht während oder infolge der Bewegungen dieses Sommers verhaftet oder ausgewiesen worden wäre und so das Schicksal erreicht hätte, das die Kölner Polizei so gütig war, ihm zu bereiten. Ein Teil der Setzer ging nach der Pfalz und trat in die Armee.
Auch die rheinische Insurrektion hat tragisch enden müssen. Nachdem drei Viertel der Rheinprovinz in Belagerungszustand versetzt, nachdem Hunderte ins Gefängnis geworfen worden, schließt sie mit der Erschießung dreier Prümer Zeughausstürmer am Vorabend des Geburtstags Friedrich Wilhelms III. von Hohenzollern. Vae victis! <Wehe den Besiegten!>